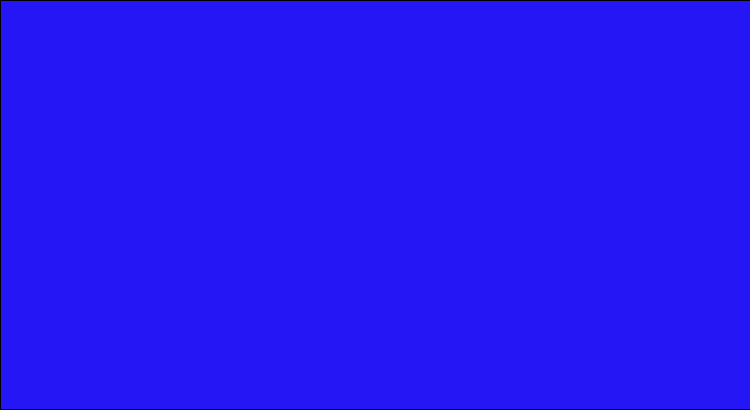Für die vorletzte Ausgabe des Diakonie-Magazins dialog habe ich Niko Paech interviewt. Ich finde seinen Ansatz der Postwachstumsökonomie total spannend und zukunftsweisend. Dementsprechend war ich sehr aufgeregt als ich persönlich mit ihm sprach. Und ja, er ist megaeloquent und superschlau, aber auch freundlich und unkompliziert. Hier kommt das Interview zu seinem Wirtschaftsmodell in voller Länge.
Postwachstumsökonom Niko Paech plädiert dafür, sich frei zu machen, von allem Wohlstandsschrott, damit die Menschheit eine Zukunft hat. Er lebt, was er an der Universität Siegen lehrt. Ein Interview.
Auf einer Skala von Rosa bis Schwarz – in welcher Farbe sehen Sie unsere Zukunft?
Ich würde die Farbe Blau wählen, weil sie im vorgegebenen Farbspektrum wahrscheinlich eher in der Mitte liegt. Ob die menschliche Zivilisation noch eine Zukunft hat, ist unsicher geworden. Wir haben die Kontrolle über die Gestaltung moderner Gesellschaften verloren, weil die Technisierung und Globalisierung sowohl der Wirtschaft als auch der Lebensweise sehr weit vorangeschritten sind. Regierungen bringen nicht den Mut auf, Grenzen zu setzen, um die Energie- und Ressourcenverbräuche dergestalt zu senken, dass noch eine Überlebenschance besteht. Diese Sicht wird noch negativer, wenn man die aktuellen Krisen hinzunimmt, denn sie zeigen, wie verletzlich die vorherrschende Lebensweise geworden ist: Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, der Pandemie, der Lehman-Brothers-Krise, des Klimawandels und so weiter zeigen, dass das aktuelle Wohlstandsmodell nicht mehr zukunftsfähig ist.
Sie malen ein sehr düsteres Bild. Gibt es auch Positives zu erkennen?
Die vorgenannten Krisen werden zum Motor eines Wandels zum Weniger, weil sie uns lehren, mit weniger Kaufkraft würdig zu leben. Das heißt: Wir werden den Wohlstand früher oder später herunterfahren.
Sie sagen, dass Krisen eine Veränderung bewirken, aber nach Corona sind beispielsweise mehr Menschen Auto gefahren als zuvor. Ist das Ihrer Meinung nach ein vorübergehendes Phänomen?
Einerseits wächst mit jeder Krise die Anzahl an Menschen, die nicht mehr an eine Fortsetzbarkeit des derzeitigen ruinösen Lebensstils glaubt, auch wenn es sich dabei vorläufig noch um eine Minderheit handelt. Andererseits sind viele Menschen durch die Corona-Pandemie und den Lockdown in ihren Konsumund Mobilitätsgewohnheiten derart eingeschränkt worden, dass sie nun glauben, ein Anrecht auf nachholenden Genuss zu haben. Aber das lässt sich langfristig nicht durchhalten, weil sich dessen Finanzierbarkeit mit jeder weiteren Krise verschlechtert. Auch die staatliche Strategie, die Krisenfolgen gemäß dem Motto „Geld-drucken-bis-das-Papier-ausgeht“ zu kaschieren, lässt sich nicht aufrechterhalten.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Wachstumsgesellschaften über ihre Verhältnisse leben und mehr Ressourcen verbrauchen, als ihnen global gesehen zustehen. Unser Fortschritt beruhe auf Plünderung. Was heißt das?
In den Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften ranken sich viele Erzählungen um die Herkunft unseres Wohlstandes. Dabei wird auf die Schaffenskraft, die Produktivität, den Erfindungsreichtum und den Wagemut der Menschen verwiesen, die diesen Reichtum erarbeitet haben sollen. Das kann nicht stimmen, denn der wachsende Wohlstand ist physischer Art, während Menschen immer weniger physische Arbeit verrichten. Wie erklärt sich dieses Wunder? Es sind die Technisierung, die Elektrifizierung, die Automatisierung, die Digitalisierung und die Globalisierung, die den Güterreichtum haben entstehen lassen. Der menschliche Beitrag beschränkt sich zusehends auf ferngesteuerte Plünderung oder die Bedienung von energieumwandelnden Maschinen, statt selbst zu arbeiten. Folglich entspräche es keinem Verzicht, sondern der Rückgabe einer Beute, wenn der Wohlstand an das heranfgeführt wird, was durch plünderungsfreie Arbeit erzielt werden kann. Die Ansprüche auf ein menschliches Maß herabzusenken, wie der Ökonom Ernst Friedrich Schumacher es einst nannte, entspräche einer Wiederherstellung globaler Gerechtigkeit.
Wie könnte eine Welt aussehen, die sich vom Wachstumsparadigma befreit? Wie sieht Ihr Modell der Postwachstumsökonomie aus?
Die Postwachstumsökonomie beruht darauf, Reduktion zu organisieren – und zwar sozialverträglich und unter Wahrung einer hohen Lebensqualität. Das setzt voraus, die Arbeitszeit zu verkürzen und umzuverteilen, damit Vollbeschäftigung in einer kleineren und nicht mehr wachsenden Ökonomie möglich ist, jedoch auf Basis einer 20-Stunden-Woche. Die freigestellten 20 Stunden können genutzt werden, um über ergänzende Eigenleistungen mit dem durchschnittlich verringerten Realeinkommen auskömmlich zu leben. Zu diesem Zweck bieten sich vier Ebenen der Gestaltung an.
Wenn wir unser Leben entrümpeln, leben wir stressfreier.
Können Sie diese vier Ebenen für uns ausführen?
Unabdingbar ist als Erstes Suffizienz. Das bedeutet, die Gesellschaft, insbesondere die Lebensstile zu entrümpeln, also sich freizumachen von all dem Wohlstandsschrott, der entbehrlich ist, weil er viel Geld kostet und die Ökosphäre zerstört. Diese Befreiung vom Überfluss sollte zuvorderst den dekadenten Luxus ins Visier nehmen: Flugreisen, Kreuzfahrten, Autos in der Innenstadt, übermäßigen Konsum an Fleisch, Wohnraum, Textilien, digitale Endgeräte etc. Dabei ist es wichtig, Grundbedürfnisse weiterhin zu erfüllen, etwa in der Ernährung und der Gesundheitsversorgung. Auch eine maßvolle Mobilität, die nötig ist, um den Arbeitsplatz zu erreichen, sollte nicht unterbunden werden. Insgesamt ist ein bestimmter Mindestkonsum in modernen Gesellschaften unabdingbar. Andererseits gilt auch: Wenn wir unser Leben entrümpeln, leben wir entspannter. Durch eine Konzentration auf das Wesentliche lässt sich eine höhere Lebensqualität realisieren als in einer reizüberfluteten Konsumsphäre, denn die begrenzte Aufnahmekapazität eines Homo sapiens verhindert, dass alles, was Menschen sich leisten können, auch ausgekostet werden kann.
Wie sieht der zweite Schritt aus?
Die freigestellten 20 Stunden können genutzt werden, um ergänzende Selbstversorgungsleistungen zu erbringen. Dazu zählen der Anbau, die Lagerung und Zubereitung von Nahrungsmitteln, aber auch die Herstellung einfacher Produkte in Werkstätten, Ressourcenzentren und an sonstigen dafür geeigneten Lernorten. So lässt sich beispielsweise aus einigen alten und kaputten Notebooks, die ausgeschlachtet werden, ein lauffähiges bauen. Genauso kann mit Möbeln, Textilien und sonstigen Gegenständen verfahren werden. Auch Dinge gemeinschaftlich zu nutzen, zählt zur Selbstversorgung. Wenn sich fünf Menschen eine Waschmaschine, ein Auto, einen Rasenmäher etc. teilen, sparen sie nicht nur viele Ressourcen, sondern vor allem Geld, für das sie sonst arbeiten müssten. Je weniger Geld benötigt wird, um über die Runden zu kommen, desto kleiner kann die Wirtschaft sein.
Noch wichtigere Subsistenzmaßnahmen bestehen in der Reparatur, dem achtsamen Umgang mit Dingen und generell der Instandhaltung, um die Nutzungsdauer von Gebrauchsgegenständen zu verlängern. Eigene Produktion, Gemeinschaftsnutzung und Reparatur bedeuten keinen Rückzug ins Private, sondern bedürfen vieler sozialer Netze und Nachbarschaften, um sich in unterschiedlichen Fähigkeiten zu ergänzen. Mit anderen Worten: Wir brauchen Freunde, um die Welt zu retten.
Was verbirgt sich hinter der dritten Stufe, der Regionalökonomie?
Dort, wo die drei genannten Strategien der Selbstversorgung an Grenzen kommen – es geht dabei schließlich nur um einfache Leistungen, die nicht alle Bedürfnisse abdecken können –, kommen kreative Unternehmer*innen als Basis einer Regionalökonomie ins Spiel: Die professionelle Reparatur, Sharing-Leistungen, eine ökologische Landwirtschaft möglichst basierend auf dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft etc. sind gute Beispiele. Zudem kann eine regionale Güterherstellung in Werkstätten und Manufakturen durch kleine und mittelständische Betriebe globale Abhängigkeiten mindern. Dies ermöglicht nicht nur geringere Distanzen zwischen Verbrauch und Produktion, sondern lässt auch mehr Arbeitsplätze als in der automatisierten Industrie entstehen.
Und wie sieht die letzte Stufe Ihres Konzepts aus?
Die restliche Industrie wird infolge der drei vorgenannten Reduktionsstufen mit einer weitaus geringeren Produktionskapazität auskommen. Nehmen wir das Beispiel Waschmaschinen. Es würden in einer Postwachstumsökonomie pro Jahr nur noch so viele Waschmaschinen produziert, wie innerhalb dieses Zeitraumes nach Ausschöpfung aller Reparaturmöglichkeiten nicht zu retten sind. Dasselbe gilt für Häuser, Möbel, Autos, Fahrräder und so weiter. Wir reduzieren den Bedarf an Gütern durch Gemeinschaftsnutzung und durch die starke Erhöhung der Nutzungsdauer. Die Rolle der Industrie besteht dann nicht darin, den Güterbestand zu erhöhen, sondern einen nicht wachsenden, innerhalb ökologischer Grenzen darstellbaren Güterbestand zu erhalten und zu veredeln. In die neuen Waschmaschinen fließt der technische Fortschritt ein, der sich zwischenzeitlich ereignet hat – insbesondere im Hinblick auf Langlebigkeit und Reparabilität. Denn in den letzten Jahrzehnten ist der frühe Verschleiß zur Maxime der Industrieproduktion geworden. Dies als Fortschritt zu bezeichnen, ist purer Zynismus.
Suffizienz bedeutet ja Verzicht …
Da muss ich Ihnen gleich ins Wort fallen: Wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, das ihm als physischer Gegenwert einer plünderungsfreien Arbeit nie zugestanden haben kann. Was ebenfalls gegen die Verwendung des Begriffs „Verzicht“ spricht, ist die bereits erwähnte Reizüberflutung. In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wurde immer übersehen, dass Konsum nur dann einen Nutzen stiften kann, wenn dem betreffenden Objekt oder der Handlung genug Zeit gewidmet werden kann, um stressfrei zu genießen. Da Zeit aber die knappste Ressource ist, über die Menschen verfügen, kann sich Konsum nur positiv entfalten, wenn er auf das Maß beschränkt wird, das sich stressfrei nutzen lässt.
Gibt es außer Krisensituationen wie die Energiekrise weitere „opportunities for change“, die eine Veränderung bewirken können?
Ein sich ausweitendes Netz an Reallaboren, wachstumskritischen Gegenkulturen und einer ökologischen Avantgarde gibt Anlass zur Hoffnung. Entscheidend für den Wandel zum Weniger sind Pioniere, die in Nischen vorwegnehmen und erproben, was zur Lösung beitragen könnte, wenn es von hinreichend vielen anderen imitiert würde. Spätestens wenn Krisen sich verschärfen und Orientierungslosigkeit um sich greift, werden auch jene, die heute keine Konsequenzen zu ziehen bereit sind, froh sein, wenn sie auf das Erfahrungswissen dieser Vorreiter zugreifen können, um in einem künftigen Zeitalter der Knappheit genügsam, aber auskömmlich leben zu können. Deshalb sollte die Nachhaltigkeitsforschung solche Aktivist*innen ermutigen, durchzuhalten, auch wenn ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Mehrheit momentan noch gering ist. Diese Minderheiten sind die Helden der Nachhaltigkeit.
Wir brauchen Freunde, um die Welt zu retten.
Wenn jemand auf Sie zukäme, der sich noch nicht mit nachhaltigem Leben beschäftigt hat, aber einen Anfang machen möchte, welche fünf Tipps würden Sie ihm mit auf den Weg geben?
Erstens wäre die individuelle CO2-Bilanz zu ermitteln. Wenn die Zivilisation überleben soll, darf pro Kopf und Jahr nicht mehr als eine Tonne CO2 emittiert werden. In Deutschland liegt dieser Wert übrigens momentan bei knapp 12 Tonnen. Anhand der persönlichen CO2-Bilanz ist sofort erkennbar, wo die naheliegendsten Reduktionspotenziale liegen. Das ist oft der Luxus. Zweitens ist es ratsam, sich danach umzuschauen, mit wem oder mit welchen Netzwerken gemeinsam eine urbane oder regionale Selbstversorgung aufgebaut werden kann: Dies umfasst die solidarische Landwirtschaft ebenso wie Repair Cafés, Tausch- und Verleihsysteme, kommunale Ressourcenzentren, offene Werkstätten, Lernorte und Lebensgemeinschaften für postwachstumstaugliche Praxis. Drittens stellt sich die Frage danach, ob die Arbeitszeit reduziert werden kann. Viertens sollten handwerkliche und Reparaturkompetenzen entwickelt werden, um möglichst viele Dinge zu retten, die andernfalls Abfall werden und überdies neu produziert werden müssten. Fünftens bietet sich eine meditative Übung an, die darin besteht, das eigene Leben aus einer Vogelperspektive zu betrachten und sich die Frage zu stellen: Welche ökologisch fragwürdigen Handlungsmuster und Dinge lassen sich erkennen, die völlig überflüssig sind, also schlicht weggelassen werden können? Sich von Wohlstandsballast zu befreien, der nur das Leben verstopft, ist eine wohltuende Übung.
Diese Minderheiten sind die Helden der Nachhaltigkeit.
Wie kann ich mir Ihre Lebensgestaltung vorstellen? Wie setzen Sie Ihr eigenes Konzept um?
Ich bin seit Ende der 1970er Jahre Vegetarier, besitze kein Auto, fliege niemals und habe kein Einfamilienhaus. Außerdem habe ich noch nie ein Mobiltelefon besessen, auch kein Tablet oder eine Spielkonsole. Ich habe keinen Fernseher, habe kein einziges elektrisches Werkzeug, und trotzdem bastle ich viel – das Werkzeug dafür leihe ich mir von Nachbarn, mit denen ich mir auch eine Waschmaschine teile. Übrigens als Gegenleistung dafür, dass ich dort Gartenarbeit verrichte, um mich körperlich fit zu halten, aber auch Reparaturen übernehme. Für öffentliche Anlässe habe ich nur eine Jeans, die nicht geflickt ist. Ich besitze verschiedene alte Rechner, von denen ich keinen gekauft habe. Stattdessen repariere oder ertüchtige ich Endgeräte, die sonst weggeworfen worden wären. Fast alle meine Möbel und meine Stereoanlage sind uralt und aufgearbeitet.
Gibt es irgendeinen Luxus, den Sie sich gönnen?
Oh ja, ich bin total verwöhnt. Ich hänge ständig in Kneipen, auf Konzerten, spiele in zwei Bands, lese viel, fahre dauernd Rad, gehe gern wandern. Leider trinke ich zu viel Kaffee, sollte weniger mit der Bahn reisen und nicht so oft im Internet sein. Und ich besitze viele Platten, CDs und viel Literatur. Aber das meiste davon wurde gebraucht gekauft. Wenn ich einen Vortrag in Bayern, Österreich oder der Schweiz halte, ziehe ich meistens gleich die Wanderschuhe an.
Prof. Dr. Niko Paech lehrt und forscht an der Universität Siegen als außerplanmäßiger Professor im Bereich der Pluralen Ökonomik. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich der Umweltökonomie, der Ökologischen Ökonomie und der Nachhaltigkeitsforschung. Er hat das Buch „Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie“ geschrieben, das bereits in der 12. Auflage erschienen ist. Vor Kurzem erschien die Streitschrift „Wachstum?“, in der Paech und die Philosophin Katja Gentinetta ihre Standpunkte zu Wachstum gegenüberstellen.